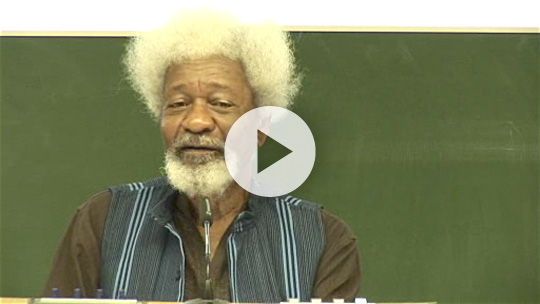-
Grenzen.
Im Kontext der Moderne werden in allen Kulturen räumliche, aber auch gedankliche Grenzlinien, die seit Jahrhunderten als unberührbar galten, überschritten. Gleichzeitig werden andere Grenzen neu gezogen und zum Teil rabiat verteidigt. Dem oft irritierenden Wechselspiel zwischen der Auflösung und der Zementierung von Demarkationslinien widmet sich das 8. Forum des Projekts Wertewelten an der Universität Tübingen.
Noch nie war eine Situation gegeben, in der es praktisch nur mehr eine Zeitrichtung gab. Wir alle spekulieren an denselben Börsen, spekulieren auf dieselbe Zukunft. Standards scheinen die Welt zusammenzuhalten, Maßstäbe sind einander zum Verwechseln ähnlich. Doch gerade aufgrund dieser Annäherungen in Echtzeit kommen Divergenzen, Widersprüche und Unvereinbarkeiten zum Vorschein. Planetarische Gleichzeitigkeit auf der einen, bleierne Zeit des Stillstands, des Leerlaufs auf der anderen Seite. Hier bewirkt Globalisierung gerade nicht eine Vereinheitlichung von Zeiterfahrung, sondern deren Auseinanderdriften. Gelegentlich hat man sogar den Eindruck, unter dem Druck der Globalisierung würden die Oberflächen (aber auch nur die Oberflächen) sich rapide einander angleichen. Alles jenseits des Firnisses der Außenseite indes droht sogar zu verhärten, jedenfalls nahezu unverändert auf der eigenen Tradition zu beharren. Der immer wieder aufflammende Streit um die „Unversehrbarkeit“ religiöser Ideen zwischen „dem Islam“ und dem Westen zeigt dies auf bestürzende Weise. Auf diesem Hintergrund geht es in der Tat um nichts mehr denn um eine Reorganisation des Phänomens der „Grenze“ (topographisch wie kulturell, in Bezug auf Räume, Gruppen, Individuen, Disziplinen). Wie gehen wir mit dem Phänomen der „Grenze“ um? Akzeptieren wir die Differenz? Suchen wir die „Übergänge“? Oder ignorieren wir sie? Durchbrechen wir sie? Respektieren wir sie? Gehen wir von einer Seite auf die andere? Gehen wir hin — und zurück? Pendeln wir, wechseln wir? Haben wir eine Identität? Suchen wir zwei Identitäten?
Um der Fülle und Vielschichtigkeit der Thematik zu entsprechen, sind drei Veranstaltungstypen vorgesehen:
- Abendvorträge
- Einzelvorträge von ca. 20–30 Minuten
- Panels, d.h. ca. zweistündige Podiumsgespräche mit jeweils ca. drei Teilnehmern aus verschiedenen Bereichen
Was die Panels betrifft, so möchten wir dieses Format erproben, um mehr Interessierten Einblick in die Arbeit von Wertewelten zu geben.
Programm.
Dienstag, 11. Juni 2013

Bild: Paul Esser20:00
Herta Müller
Grenzüberschreitungen.
Vom Ausscheren und Weggehen.
Gespräch und Lesung.
Universität Tübingen, Kupferbau, Hörsaal 25Mittwoch, 12. Juni 2013
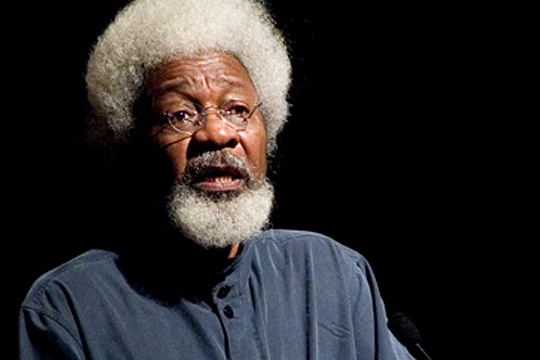
Bild: Christopher Peplin20:00
Wole Soyinka
The END OF BORDERS and the LAST MAN: Excursions in Virtual Reality.
Universität Tübingen, Kupferbau, Hörsaal 25Donnerstag, 13. Juni 1013
Alte Aula, Münzgasse 30, 72070 Tübingen
9:00–11:00
Jürgen Wertheimer (Tübingen)
Zur Dialektik der Grenze.Leo Kreutzer (Köln)
Die Grenze als Ort, von dem aus man spricht.Fawzi Boubia (Rabat/Caen)
Theorie und Praxis der „Grenze“ bei Goethe und Hegel.Chetana Nagavajara (Bangkok)
Die Problematik des europäischen Begriffs „Grenzen“: eine Re-lektüre aus buddhistischer Sicht.Anschließend Diskussion
12:15
Mittagspause
14:00–16:00
Roberto Cazzola (Mailand/Turin)
Sich versenken, um sich zu entgrenzen.
Eine uneinnehmbare Burg am Kreuzweg vieler Grenzen im Werk von Etty Hillesum.Carlotta von Maltzan (Stellenbosch)
Hilfe als Grenzerfahrung.Ulrike Kistner (Pretoria)
Rassismus ohne „Rasse”?
Überlegungen zur Frage nach dem „kolonialen Unbewussten“.Seyran Ates (Ort)
Identitäten und ihre Grenzen.Anschließend Diskussion
Kleiner Imbiss
17:15
Ronel Alberti da Rosa (Porto Alegre)
Variationen über „Unser Norden ist der Süden“: eine visuelle Grenz- und Rahmenüberschreitung.Yeon-Soo Kim (Seoul)
Grenzüberschreitung auf der koreanischen Halbinsel und eine Grenze im Kopf.Stephanie Schwerter (Paris)
Peace lines und boundary markers: zur mural language von Belfasts Stadtlandschaft.Anschließend Diskussion
Freitag, 14. Juni 1013
Pfleghofsaal, Schulberg 2, 72070 Tübingen
9:00–11:00
Karin Amos (Tübingen)
Grenzen in der Pädagogik: Aspekte und Perspektiven.Frank-Olaf Radtke (Frankfurt)
Grenzwerte — wie funktioniert der Europäische Bildungsraum?Nadjib Sadikou (Tübingen)
Grenzziehung oder Grenzüberschreitung — Wege des interkulturellen Lernens in der Moderne.Gret Haller (Bern)
Zugehörigkeit und Dissidenz.Anschließend Diskussion
12:15
Mittagspause
14:00–16:00
Heinz-Dieter Assmann (Tübingen)
Grenzziehung durch Recht — Möglichkeiten, Grenzen, Alternativen.Jochen von Bernstorff (Tübingen)
Die Menschenwürde als absolute Grenze.Christian Traulsen (Tübingen)
Grenzen der Grenzziehung: Die Anwendung von Grundrechten auf kulturell fremde Phänomene.Hans-Jürgen Kerner (Tübingen)
„Null Toleranz“ in der Kriminalpolitik, der Strafverfolgung und der Sanktionierung: Eine tragfähige amerikanische „Verheißung“ auch für Deutschland?Anschließend Diskussion
Kleiner Imbiss
17:15
Panel „Europa und seine Grenzen“
Mit Klaus Harpprecht, Sarhan Dhouib und Rudolf Hrbek (Moderation: Frank Baasner)Download.
8. Öffentliches Forum des Projekts Wertewelten
Download Programmflyer (PDF, 0,5 MB)Dokumentation.
Videomitschnitt der Veranstaltungen.
Herta Müller
Grenzüberschreitungen. Vom Ausscheren und Weggehen. (Gespräch und Lesung)Wole Soyinka
The END OF BORDERS and the LAST MAN: Excursions in Virtual Reality.Panel
Europa und seine Grenzen.1.
Europa und seine Grenzen.Koordination Baasner
Über Jahrhunderte haben die Europäer untereinander Krieg geführt, um die Staatsgrenzen neu zu definieren, Machtverhältnisse neu zu gestalten. Bis zum Ende des 2. Weltkriegs wurden Grenzen politisch gezogen, ohne nach den Interessen der betroffenen Bevölkerung zu fragen. Mit dem Prozess der europäischen Integration scheint die politische staatliche Grenze kein Anlass für kriegerische Auseinandersetzung mehr zu sein. Grenzziehungen sind nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums sogar friedlich möglich geworden. Gleichzeitig hat die europäische Integration die Binnengrenzen juristisch abgesenkt, die Freizügigkeit für Menschen, Kapital, Waren und Dienstleistungen hat in der Wahrnehmung vieler Bürger die Grenzen innerhalb der EU vollständig verschwinden lassen.
In dem Maße, wie die politischen Binnengrenzen in der EU an Bedeutung verlieren, stellt sich die Frage der Außengrenzen. Und zwar in zweierlei Hinsicht:
- Wo soll der europäische Einigungsprozess enden? Kann man sinnvolle kulturelle oder politische Grenzen definieren?
- Wie soll sich die EU zu ihrer unmittelbaren Nachbarschaft in Osteuropa/Asien und Afrika verhalten? Darf, soll oder muss vielleicht die EU ihre eigenen Werte auch in der näheren Umgebung verteidigen und/oder durchzusetzen versuchen („Die deutschen Interessen werden am Hindukusch verteidigt“)?
Diese Fragen sollen sowohl als europäische Fragen diskutiert werden als auch Vertretern aus anderen Regionen der Welt zur vergleichenden Analyse angeboten werden.
2.
Menschenrechte — grenzenlos?Koordination Assmann
Grenzen setzen und verteidigen ist eine der wesentlichen Aufgaben des Rechts. In der westlichen Moderne erfolgt dies einmal dadurch, dass hoheitlichem Handeln Grenzen gezogen und dem Individuum Abwehrrechte gegen den Staat gewährt werden, und zum anderen in der Weise, dass die Freiheit des einen dort endet, wo sie die Freiheit des anderen beeinträchtigt. Entsprechend unterschiedlich fallen hier die Instrumente und Sanktionen aus, mit denen der Überschreitung rechtlich gesetzter Grenzen Einhalt geboten wird. Und nicht selten gerät hierbei Recht selbst an seine Grenzen.
Aus diesem weiten Feld der Setzung, Durchsetzung und Überschreitung der durch Recht gezogenen Grenzen wollen wir beispielhaft einige Konfliktzonen herausgreifen, welche das Besondere der Grenzziehung durch Recht beleuchten und gleichwohl auch bei juristisch nicht vorgebildeten Symposiumsteilnehmern auf Interesse stoßen dürften.
- Menschenwürde als absolute Grenze und universelle Rechtsidee (am Beispiel der so genannten „Rettungsfolter“, d.h. Gewaltandrohung oder gar Gewaltanwendung zur Erzwingung einer Aussage in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren zum Zwecke der Rettung von Menschenleben — Entführungsfall Jakob von Metzler).
- „Das Leben der Anderen“ — Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht als privatrechtliches Instrument zum Schutz von Personen vor Eingriffen in den Lebens- und Freiheitsbereichs Anderer (dazu gehört etwa der Schutz der Privat-, Geheim- und Intimsphäre, Ehrschutz, informationelle Selbstbestimmung).
- „Null Toleranz“ — Verstärkung und radikale Durchsetzung von Sanktionen auch für leichte Vergehen als Mittel der Kriminalprävention (nach der so genannten „broken windows“-Theorie).
- Menschenrechte — Menschenpflichten.
- Grenzen der Grenzziehung: Die Anwendung von Grundrechten auf kulturell fremde Phänomene (Bspe. Schächten, Beschneidung, Religiöse Symbole in Schulen etc.).
3.
Erziehung zur Grenze — Grenzen der Erziehung — entgrenzte Erziehung?Koordination Amos
Durchaus auch im Zusammenhang zur Orientierung an „Null Toleranz“ hat die Debatte um Gehorsam und Disziplin in jüngster Zeit wieder Konjunktur. Kritik an Erlebnispädagogik zur Rehabilitation von gestrauchelten Jugendlichen geht einher mit der Zustimmung zu Boot Camps. Aber auch ohne diese punitive Ausrichtung, werden Disziplin und Gehorsam (Unterwerfung) wieder als wichtige Werte gesehen. Denkverbote, Disziplin, festgelegte Regeln stehen als ordnungspädagogische Maßnahmen hoch im Kurs. Diese Ausrichtung geht einher mit einer Kritik an einer Erziehung zur Grenzüberschreitung.
Die prominente Platzierung dieser Werte geht einher mit einem fast grenzen-losen Optimismus in die Möglichkeiten der Pädagogik. Vergessen scheinen die Mahnungen Sigfried Bernfelds, der unter dem bezeichnenden Titel: Sisyphos ausführlich über die Grenzen der Erziehung reflektiert und dort unter anderem darauf hinwies, dass die Möglichkeiten der Erziehung immer auch von den gesellschaftlichen Kontexten abhängig sind.
Diese gesellschaftlichen Kontexte haben sich seit dem letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts radikal zu verschieben begonnen. Erziehung ist gleichzeitig national eingebettet und entgrenzt; letzteres durch Projekte wie die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Bildungsraums, der weit über die aktuellen Grenzen Europas ausstrahlt und durch den großen Einfluss Internationaler Organisationen. Die intendierte Verbesserung der Erziehung durch Schülerleistungsmessungen gebunden an „high stakes“ birgt zu diskutierende Risiken und Nebenwirkungen. Ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang: Auflösen der separierenden und segregierenden Grenzen durch Inklusion. Welche neuen Grenzen werden gezogen?
(Pädagogen, Soziologen, Psychologen, Theoretiker und Praktiker kommen als Diskutanten in Frage)
4.
Tabuzonen: Ab wann mischen wir uns ein?Koordination Wertheimer
Null Toleranz gegen Intoleranz ist eine derzeit gängige Losung. Andererseits gilt in liberalen Gesellschaften die Doktrin der weitgehenden Nichteinmischung in die Belange anderer.
Frage also: ab wann fühlen wir uns veranlasst, dennoch einzuschreiten und unsere Vorstellungen durchzusetzen?
Und: Mit welchen Mitteln tun wir das?
Wie kann mit sprachlichen, künstlerischen, literarischen Mitteln Einmischung erfolgen?
Sicherlich bilden sprachliche Regularien den Status unserer jeweiligen Bereitschaft zum Interagieren oder Relativieren, zum Protest bzw. zur Distanzierung ab. Erinnerlich sind noch immer die Aufrufe Stéphane Hessels, die mit der Aufforderung ich zu „entrüsten“ Tausende erreichten und mobilisierten. Dennoch stellt sich die Frage, ob diese Entrüstungs- und Engagementswellen wirklich Grenzen überwinden oder ob sie — um im Bild zu bleiben — nach einiger Zeit verebben.
Darüber hinaus ist zu fragen, wie Formen des Widerstands und des Einspruchs sowie des Rechts, Grenzen zu überschreiten, gegenwärtig immer mehr durch elektronische Netzwerke aufgebaut werden.
(Politologen, Kulturwissenschaftler, Medienwissenschaftler, Literaturwissenschaftler)